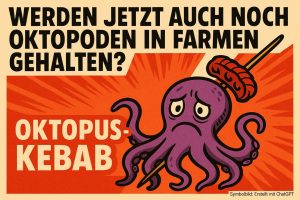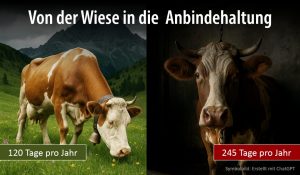Anhören 🔊
„Deutsche Wolle? Ein Tropfen auf den heißen Stein“
Nur ein winziger Teil der Wolle, die in Deutschland verarbeitet wird, stammt aus deutscher Schafhaltung.
-
Deutsche Schafe werden hauptsächlich für Landschaftspflege, Fleisch oder Milch gehalten.
-
Wolle ist ein Nebenprodukt, wirtschaftlich nahezu wertlos: Fürs Scheren zahlen viele Schäfer mehr, als sie durch den Verkauf der Wolle bekommen.
-
Grobe deutsche Wolle landet meist in Dämmstoffen, Teppichen oder Filz – nicht in Kleidung.
Unsere Kleidung wird fast ausschließlich aus importierter Wolle hergestellt.
„Dein Pullover kommt fast nie aus Deutschland“
Kleidung aus Wolle besteht fast immer aus australischer oder neuseeländischer Merino-Wolle.
-
Merino ist fein, weich und billig in großen Mengen.
-
Heimische Wolle ist zu grob und wird kaum in Mode verarbeitet.
„Urschafe mussten nie geschoren werden“
Die ursprünglichen Wildschafe haben nur so viel Wolle gebildet, wie sie selbst gebraucht haben.
-
Ihr Fell stößt sich saisonal ab (wie Winterfell bei Wildtieren).
-
Erst Zucht auf maximale Wollproduktion hat Tiere hervorgebracht, die ohne menschliches Eingreifen krank werden würden, weil ihre Wolle unkontrolliert weiterwächst.
-
Das Problem ist also menschengemacht.
„Das Scheren selbst ist kein Wellnessprogramm“
Schafe erleben Scheren nicht als Wellness, sondern als extremen Stress:
-
Sie werden festgehalten oder fixiert, was Panik auslöst.
-
In industriellem Tempo wird geschoren, was oft zu Schnittwunden führt – nicht selten so tief, dass sie genäht werden müssen.
-
Es geht nicht um Ruhe für das Tier, sondern um Geschwindigkeit.
-
Verletzungen, Blut und Stress sind Alltag.
Bei Wildschafen gäbe es diesen Stress nicht – sie würden ihr Fell einfach selbst loswerden.
„Giftbäder für Schafe – mehrmals im Jahr“
In Australien und Neuseeland werden Merinos regelmäßig in Chemikalien getaucht, um Parasiten wie Fliegenmaden oder Läuse zu bekämpfen.
-
„Sheep Dip“: Schafe werden in eine Wanne gedrückt und komplett in Giftflüssigkeit getaucht.
- Die Tiere haben Panik zu ertrinken.
-
Häufig verwendete Mittel: Organophosphate oder Pyrethroide – extrem giftig.
-
Diese Prozedur wiederholt sich mehrmals im Jahr.
Die Chemikalien belasten Tiere und Umwelt, und alte Dip-Stationen sind bis heute kontaminiert.
„Mulesing – Haut rausschneiden ohne Betäubung“
Australische Merinos wurden so gezüchtet, dass ihre Haut viele Falten bildet.
-
In diesen Falten sammeln sich Kot und Urin – ein perfekter Nährboden für Fliegenmaden.
-
Die Lösung der Industrie: Mulesing.
Beim Mulesing werden Lämmern ohne Betäubung große Hautstücke um den After herausgeschnitten.
-
Es bleiben blutige, offene Wunden zurück.
-
Die Tiere leiden wochenlang an Schmerzen.
In Australien ist Mulesing Standard. Neuseeland hat es verboten.
„Gift statt Zucht mit Hirn“
Die Industrie könnte auf Zuchtlinien setzen, die resistenter gegen Parasiten sind und weniger Hautfalten haben.
-
Diese Programme existieren, aber sind langsam und teurer.
-
Deshalb wird weiterhin auf Gift und Mulesing gesetzt.
„Umweltbelastung inklusive“
Die Chemikalien aus den Bädern und Sprays belasten Böden, Grundwasser und Flüsse.
Viele alte Dip-Stationen gelten noch heute als kontaminiert.
„Fazit: Mode auf Kosten von Tieren“
-
Die allermeiste Kleidung aus Wolle kommt aus Australien oder Neuseeland.
-
Deutsche Wolle spielt keine Rolle in Mode.
-
Die Produktion basiert auf Zwangszucht, Verstümmelung, Giftbädern und Stress.
Wer Tierleid vermeiden will:
-
Nur Wolle mit klaren Siegeln kaufen (RWS, ZQ, NATIVA – mulesing-frei)
-
Oder auf pflanzliche Alternativen wie Hanf, Leinen oder Baumwolle setzen.
Ist Merinowolle Tierquälerei? Alles über das Leid der Schafe
https://www.peta.de/themen/merinowolle/